k-bulletin nr.3 <kollektive/arbeit>
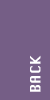




| Crewphobia Ein Kollektiv ist mehr als die Summe seiner Teile Bei jedem Jahrzehntwechsel, in diesem Fall Jahrtausendwechsel, entsteht das Bedürfnis, diese Zeitenwende durch bedeutende kulturelle Transformationen zu bestätigen und zu legitimieren, mit der Absicht, den zeitlichen Einschnitt durch grundlegende soziale Veränderungen erst verständlich und sinnvoll zu machen, so als würde es erst aufgrund dieser Veränderungen das besondere Datum geben. Der Shift wird gewissermassen durch die Zeitenwende messbar und damit objektivierbar. "Woher weiss man, dass sich die Zeiten wenden? Die Zeiten wenden sich nie. Es gibt den Paradigmenwechsel, die kommen immer wieder mit demselben Anzug, oder mit einer Krawatte oder mit Schuhen. Ich habe keine Ahnung, was die Paradigmen tun. Sagen Sie mir doch, was ein Paradigmenwechsel ist. Wir sind Opfer dieser Slogans. Zeitenwende. Paradigmenwechsel." (Heinz von F&Mac185;rster im Gespräch, "Realität kostet fünf Dollar", in: Heide Baumann, Clemens Schwender (Hg.), Kursbuch Neue Medien 2000, Düsseldorf 2000, S. 84) Von einigen Opinion Leadern und Anheizern des Kunstmarkts wird gegenwärtig der Shift zur individuellen, vorwiegend von Gefühlen geleiteten künstlerischen Arbeit propagiert und von vielen Medien aufgegriffen und reproduziert. Vorangegangen ist die allmähliche Diskreditierung der kollektiven, politisch motivierten und häufig als konzeptionell oder interventionistisch bezeichneten kulturellen Produktion. Auffallend ist, dass diese Abwertung nicht nur von reaktionären Kreisen, sondern von Leuten aus dem eigenen Umfeld betrieben wurde. Vermutlich ist das der Grund, warum ihre Worte so häufig auf fruchtbaren Boden fielen und zum Obsoletwerden des Kollektivs beitrugen, auch wenn dies nicht ihre eigentliche Absicht war. Aber ist die kollektive kulturelle Arbeit wirklich ein Old Boring Fart? Hat sie sich in den 90er Jahren tatsächlich selbst demontiert oder irgendjemanden verkauft? Mit "Kollektiv als Design" ist ein Abschnitt in Hans-Christian Danys Aufsatz "Hallo 2000. Zu Politisierung, Kunst, Identität in den letzten sieben Jahren" in dem von ihm mitherausgegebenen Band "dagegen dabei" (Hamburg 1998) überschrieben. Dany war selbst Mitbegründer der Organisation UTV, und damit ein Mitinitiator von kultureller kollektiver Tätigkeit. In diesem Aufsatz kritisiert er häufig zu Recht Fehlannahmen und -entwicklungen der Kunst der 9oer Jahre. Auf einige seiner Argumente, warum das Kollektiv zum Design verkommen sei, m&Mac185;chte ich hier jedoch näher eingehen. So schreibt er: "Es blieb also im Rahmen überschaubarer Irrtümer und Entfremdungen, wie dem, dass es sich bei einer Gruppe im Kreis sitzender und diskutierender Menschen um Kunst und Politik handelt." Doch selbst im Feld der Kunst ist niemand so naiv zu denken, dass, wenn sich eine Gruppe über politische Themen und Aufgaben unterhält, damit ein wichtiger künstlerisch-politischer Beitrag geleistet würde. Andererseits um eine gemeinsame politisch relevante Aktion zu starten, kann es durchaus nützlich sein, darüber vorher zu reden. Die Diskussion in einer Gruppe war fast immer nur ein erster Arbeitsschritt, auf den andere folgten. Folgten sie nicht, bedeutete es gewöhnlich das Scheitern eines Projekts, oder es war sowieso nicht ernsthaft betrieben worden und diente vorwiegend zur Erlangung eines social chic-Attributs. Das Scheitern wurde häufig mit dem Argument, man hätte zumindest die Unmöglichkeit des gemeinsamen Handelns in dieser Konstellation festgestellt, bagatellisiert. Im Unterschied zu Danys Behauptung wurde nur höchst selten das Diskutieren als der Kern der kulturell-politischen Aktivität begriffen. Wenn das organisierte Debattieren, z.B. bei "Services" (Lüneburg 1994), auf Video aufgezeichnet wurde, dann deswegen, weil mit anderen Textproduktionsformen als der Herausgabe eines Buches experimentiert wurde. Und weniger "das gemütliche Einrichten", wie Dany meint, sondern nach meiner Beobachtung viel mehr die Enttäuschung, wie kraftraubend und diffizil eine Einigung sein kann, kennzeichnet die Arbeit im Kollektiv der 90er Jahre. Nicht wenige hatten sich die gemeinschaftliche Arbeit einfacher und vergnüglicher vorgestellt. Da im Bereich der Kunst die Analyse kollektiver Arbeitsformen auch historisch gesehen weitgehend fehlte, herrschte vielfach das Trial and Error-Prinzip vor. Im Kollektiv zu arbeiten, bedeutete deshalb, sich nicht nur mit Zielen sondern auch mit Regeln beschäftigen zu müssen. Und so war es auch nicht erstaunlich, wenn dabei immer wieder Irrwege beschritten wurden. Eine der Hauptschwierigkeiten in der kollektiven Praxis ist die Suche nach einer geeigneten (Macht-)Struktur. Sie ist eng mit der Form der Selbstlegitimation, die sich jede Gruppe gibt, verbunden. Diedrich Diederichsen beschreibt dabei Ausschlussmechanismen als geradezu konstituierend für Gruppenzusammenhänge. Mit dem Ausschluss von Personen werden Richtlinien aufgestellt und die Relevanz der Gruppe zum Ausdruck gebracht, ihr gerade mit dieser einschneidenden Massnahme Bedeutung verliehen. Diedrichsen beschreibt diese Vorgänge anhand mehrerer Beispiele der Kunst des 20. Jahrhunderts wie den Surrealisten oder der Situationistischen Internationale (vgl. Künstlergruppen: Legitimität und Illegalität, Avantgarde und Menschenopfer, in: heaven sent, Nr. 6, 1992, S. 74-85). Diese Praxis kritisiert Hans-Christian Dany an den Kollektiven der 90er Jahre. Richtig ist, dass die emanzipatorische Absicht bisweilen durch einen seltsamen Anspruch auf Exklusivität untergraben wurde. Dagegen ist zu argumentieren, dass sich Gruppen immer eingrenzen und abgrenzen, um zur Gruppe zu werden. Vereine ziehen diese Grenze durch Mitgliedsbeiträge, in Künstlerkollektiven basiert die Exklusion/Inklusion auf weniger materiellen, ungreifbareren Kriterien. Diederichsen deutet diese Gruppenzwänge u.a. psychologisch und beschreibt sie als "neue interne †ber-Ichs" (Der lange Marsch nach Mitte, Köln 1999, S. 217). Eine Frage, die ebenfalls jedes Kollektiv bewegt, heisst: Wie halten wir es mit dem Einzelnen? Wie weit muss er/sie sich dem Gruppeninteresse unterordnen? "Sich als 'guter' Künstler hervorzutun, war der erste Schritt zum Verrat", kennzeichnet Dany die Situation in den Gruppen der 90er Jahre. Dabei gab es tatsächlich nur wenige Fälle, in denen die Individualität eines/r Künstlers/In mehr oder weniger unfreiwillig unter den Tisch gekehrt wurde. Mir ist nur eine sehr kleine Anzahl von Ausstellungen bekannt, bei denen die Namen der TeilnehmerInnen (z.B. When tekkno turns to sound of poetry, 1994/1995) gezielt in den Hintergrund rückten. Daneben gab und gibt es jene KünstlerInnengruppen, die ähnlich wie verschiedene Popmusik-Bands ganz bewusst auf eine individuelle Nennung verzichten. Der Einzelne nutzt das Kollektiv dazu, sich hinter den Namen der Crew zu verbergen und wählt aus verschiedenen kunststrategischen Gründen die Anonymität eines Organisationslabels mit symbolischem Gewicht, oft um den Individualismuszwang im Kunstsystem etwas entgegenzusetzen. Dem Kollektiv dann eine "stalinistische Tendenz" zu unterschieben, die überall Verräter sieht und letztlich kreiert, ist verfehlt, wenn man bedenkt, wieviele KünstlerInnen sich innerhalb von kollektiven Kunstformen in der Ausstellungspraxis tatsächlich "hervorgetan" haben. Gerade das Herauspicken der GaleristInnen und KuratorInnen von für den Kunstmarkt kompatiblen Werken und KünstlerInnen leistete nicht selten Beihilfe in der Auflösung von Gemeinschaften (Botschaft e.V., Freie Klasse München etc.). Zwei weitere Tendenzen beschreibt Dany: das Kollektiv wäre im Laufe der letzten Jahre "zum Design verkommen" und zur "Konvention geworden". Eine kollektive Arbeitsform bedeutet zunächst keine Festlegung auf eine bestimmte kulturelle Artikulation bzw. Bildsprache. Wenn in den 90er Jahren diskursive Praxen und eine interventionistische, aktionistische, politisch-konzeptionelle Orientierung innerhalb der Kollektive vorherrschten, dann heisst dies keinesfalls, dass dabei ähnliche Ergebnisse (in Form von Installationen, Filmen, Arbeiten im öffentlichen Raum, Aktionen, Büchern, CDs, Fanzines, Objekten etc.) entstanden oder die ProduzentInnen bilderfeindlich gewesen wären, wie Dany unterstellt ("Das zurückgehaltene bildnerische Element..."), auch wenn in jenen Jahren die Frage von Repräsentation und Visualität in der Tat intensiv diskutiert wurde. Konvention konnte das Kollektiv bei der geringen Anzahl von Gemeinschaften sowieso nicht werden. Vielleicht gab es Anfang der 90er Jahre einen kleinen Hype, der zur verstärkten Gründung von Gruppen führte. Aber allgemein gesehen blieb das Phänomen Kollektiv in der Kunst ein viel zu peripheres, um zum Standard zu werden. Wenn Dinge so vereinzelt auftreten, dann können sie kaum als konventionell bezeichnet werden. Die eigene Szene wird hier offensichtlich überbewertet. Mit dem Schluss seiner Ausführungen untermauert Hans-Christian Dany theoretisch den Shift zum Künstlerindividuum des neuen Jahrtausends. Er greift dabei auf eine Lektüre von Balthasar Gracians "Der Held" zurück, die kaum jemand kennt, und so in gewissem Sinne unangreifbar bleibt. Diese "demokratische Helden-Theorie" liefert für den Autor eine vorbildhafte Anleitung für das Verhalten der KulturproduzentInnen in unserer heutigen Gesellschaft. Zu den "Meisterschaften" dieses Helden zählen die Unergründlichkeit seiner Fähigkeiten, die Sparsamkeit des Lobes und &Mac173;hnliches. Aus dem richtigen Einschätzen von Ort und Zeit für das Handeln, macht Dany eine Forderung nach Originalität, die der politisch ambitionierten Kunst im deutschsprachigen Raum als vermeintliche Nachahmung amerikanischer Kunstproduktion kategorisch abgesprochen wird. Insgesamt sei Gracians Held bestens als Role Model für KünstlerInnen im Nullen-Jahrzehnt denkbar. Aber brauchen wir in der gegenwärtigen gesellschaftlichen Situation überhaupt einen Helden, egal ob er sich Demokrat, Spinnenmann, Wunderfrau oder Grüne Laterne nennt? Denn Held und Genie gehören zum gleichen obsoleten ideologischen Set. Der Ausverkauf des Kollektivs geschah nach Diederichsen und Dany auch dadurch, weil sich die Wirtschaft die in den 90er Jahren von KünstlerInnengruppen entwickelten Arbeitsweisen einverleibte. Die Integration von aus dem Kulturbereich stammenden Praxen und die Einrichtung von selbstverantwortlich arbeitenden, kleinen Arbeitseinheiten, in denen Phantasie und Kreativität gefordert werden, habe demnach reflexiv auch der kollektiven kulturellen Arbeit geschadet. Kollektive Praxen seien dann nicht mehr brauchbar, wenn sie der Kapitalismus selbst anwendet. "Dass der Unternehmer letztlich ein Modell des Kreativen sei, ist vor allem heute ein von der Selbstpropaganda der Wirtschaft gerne verbreitete Behauptung", bemerkt Diedrich Diederichsen in dem Aufsatz "Selbstausbeutung - Von der Ökonomie der Subkultur zur Ökonomie von Berlin-Mitte" in seiner Aufsatzsammlung "Der lange Weg nach Mitte". In der Zeitschrift frieze schreibt er von der Aneignung der Idee des kollektiven Experiments als Utopie: "cultural circles of the German managerial elite, for example, hold symposia with titles such as 'The Artist as Entrepreneur' or 'Art as the Avant-garde of Economy'" (Paradise Postponed, frieze, No. 51, S. 72). Sowohl Diederichsen als auch Dany weisen mehrfach auf die grosse Nähe von Arbeits- und Denkformen in Kultur und Wirtschaft hin. Das Entscheidende dabei ist aber, welche Schlüsse aus dieser Nähe gezogen werden. Zunächst sagt die strukturelle Verwandtschaft von Arbeitsweisen nichts über deren inhaltliche Zielsetzung aus. Dass beispielsweise in einer Fussballmannschaft heute weniger Hierarchie und mehr kreativer Freiraum für den Einzelnen als zu Herberger-Zeiten herrschen, macht den Vergleich etwa zu Arbeitsweisen von Künstlergruppen immer noch nicht leichter. Aus solchen Ähnlichkeiten lässt sich höchstens auf gesamtgesellschaftliche Entwicklungen schliessen, die man u.a. mit "Kulturalisierung der Ökonomie" bezeichnen könnte. Im Spätkapitalismus gleichen sich, und dies ist durch viele Beispiele belegbar, Kultur und Ökonomie immer mehr an. Im Unterschied zu Kollaborationsformen in anderen kulturellen Bereichen, z.B. die Band in der Popmusik oder das Team einer Filmproduktion, gibt es in der Kunst keine tradierten, allgemeingültigen Verhaltensweisen. Als Künstler im Kollektiv arbeiten, heisst deshalb: mit Arbeitsweisen zu experimentieren. Innovative Formen der Zusammenarbeit entstehen zur Zeit wegen ihrer multimedialen, kommunikationsorientierten und integrativen Möglichkeiten vor allem im Kontext von net.art und net.activism. Als gemeinsames Format dient hier oftmals die Website im Internet. Bisweilen funktioniert sie wie ein Sampler eines Plattenlabels. Personen aus verschiedenen Staaten oder Kontinenten (z.B. bei irational.org) liefern hierfür eigene Beiträge. Sie stehen mehr in einem inhaltlichen als einem formalen Zusammenhang. Zusätzliche Links signalisieren eine Vernetzung über die Site hinaus. Zudem gibt es Künstlergruppen, die gemeinsam an einer Website arbeiten (z.B. etoy, Critical Art Ensemble, Redundant Technology Initiative), in denen die Namen der einzelnen MitarbeiterInnen nicht auftauchen. Oder es gibt Gruppen von NetzaktivistInnen und -künstlerInnen, in deren Zentrum nicht der virtuelle, sondern ein realer Raum, eine Workstation, steht bzw. stand (z.B. Access Space, K 3000, Backspace). In Mailing-Listen trifft man auf eine erstaunliche Textproduktion zu Kultur und Gesellschaft. Jedenfalls scheint das Netz und die Arbeit mit dem Computer derzeit die meist genützte Plattform zu sein, auf der Formen kollektiver kultureller Arbeit erprobt werden. Die in den USA lebende Künstlerin Natalie Bookchin beschreibt in knapper Form, was man dabei beachten sollte: "I found this friendship and collaboration as a result of the Internet. (...) Collaboration has been extremely appealing to me, in part because I am most interested in making complex and substantial connections with other people and least interested in work that is about self-analysis, expression and self-promotion. In a successful collaboration, you have to leave behind narcissism and the isolated and heroic self quite a bit. (...) I think that with collaboration you have to remain open to the possibility that something other than what you are planning and expecting results from your activities, and that includes where your results might end up and what form they might take. (aus einem von nettime veröffentlichten, per e-mail geführten Gespräch zwischen Natalie Bookchin und Alexej Shulgin, Januar 2000). Zur kollektiven Arbeit gehört eben die Bereitschaft, Unvorhergesehenes zuzulassen, etwas, was andere erst bewirken und in einem selbst auslösen, etwas, was man so nicht erwartet konnte. Justin Hoffmann <Justin.Hoffmann@adbk.mhn.de> |