k-bulletin nr.3 <kollektive/arbeit>
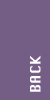




| Ich finde gemeinsam was Eigenes erfinden eine ganz gute Alternative! Chancen und Widersprüche einer unabhängigen kulturellen Praxis am Beispiel selbstorganisierter Kunstprojekte in den 90er Jahren in Zürich Kurator / Kuratorin gesucht Diese Annonce erschien sogar im Kunst-Bulletin: „Der Projektraum Hohlstrasse sucht einen Kurator / eine Kuratorin.“ Was auf Insider wie ein Scherz wirkte, war ernst gemeint. Nachdem aus dem Kreis der in der Ateliergemeinschaft an der Hohlstrasse arbeitenden KünstlerInnen niemand mehr das Programm für den Ausstellungsraum zusammenstellen wollte, wurde jemand Auswärtiger gesucht, um das Projekt weiterzuführen. Aber die ausgeschriebene Stelle war nur eine halbe Sache: Der Ausstellungsraum war zwar gerade renoviert worden, aber neben der Hoffnung, der gute Ruf des Projektraumes würde jemanden herausfordern, gab es kaum Ressourcen für ein zukünftiges Programm. Der <Projektraum Hohlstrasse>, einer der ersten von KünstlerInnen selber organisierten Ausstellungsräume in Zürich, befand sich zu dem Zeitpunkt in einer merkwürdigen Lage: Er hatte bereits zu lange existiert, um einfach stillgelegt zu werden, war aber zu wenig etabliert, um in eine öffentliche Institution transformiert zu werden. Der Versuch, auf die schwindende Motivation der sich auflösenden kollektiven Trägerschaft mit der Einführung eines traditionellen Kuratoriumsmodell zu reagieren, war die letzte von unzähligen Anstrengungen, das Projekt zu retten. Subkulturelle Zusammenhänge, selbstorganisierte Orte und temporäre kollektive Projekte gibt es in der Kunst – nicht nur in Zürich – seit Dada immer wieder. Sie entstehen dort, wo nachgefragt wird, was Kultur überhaupt und im Speziellen die eigene Kultur ist, und wo Legitimierungsansprüche und Distinktionsgewohnheiten ignoriert, geltende Rollen wie die von ProduzentInnen und VermittlerInnen aufgelöst und die institutionelle Ordnung hinterfragt werden. Subkulturelle Praxis und die damit verbundenen temporären alternativen Zusammenhänge und Projekte waren immer die wesentliche Voraussetzung für neue Ausdrucksweisen, Bedeutungen und Ideen in der Bildenden Kunst. Dem gegenüber steht der eigentliche Kunstvermittlungs-, Verwertungs- und Verwaltungskomplex, welcher sich aus traditionellen Institutionen wie Museen, Galerien und Messen, den Kunstmagazinen und ihrer Berichterstattung und damit verbunden der Kunstgeschichtsschreibung zusammensetzt. Hier finden Ideen eine breitere Öffentlichkeit, sie werden verbreitet und verstärkt aber auch selektiert, legitimiert und verwertet. Der Konflikt zwischen den Anliegen basiskultureller Bewegungen und den Bedürfnissen des Kunstvermittlungssystems (und des daran angeschlossenen Kunstmarktes) ist Teil einer andauernden Auseinandersetzung um die Definitions- und Verfügungsmacht in der Kultur. Diese unterschiedlichen Interessen werden sich auch in Zukunft nicht mit einfachen Vorschlägen relativieren lassen, wie etwa durch die schon oft propagierte Versöhnung zwischen Kommerz und Kultur oder die Behauptung, basiskulturelle Bewegungen seien eine „natürliche Phase“ am Anfang jeder erfolgreichen individuellen Karriere. Die folgenden Beobachtungen entstanden im Umfeld von verschiedenen unabhängigen Kunstprojekten in Zürich in den 90er Jahren. Sie beschreiben sowohl Chancen und Möglichkeiten als auch Abhängigkeiten und Widersprüche, in die man sich unweigerlich verwickelt, wenn man selber etwas erfindet und dabei unabhängig bleiben möchte. Hinter dem <Projektraum Hohlstrasse> stand die Initiative der KünstlerInnen, die 1986 gemeinsam in ein Gewerbegebäude am Rand der Gleisfelder des Güterbahnhofs eingezogen waren. Neben den individuellen Ateliers auf den verschiedenen Etagen wurde 1990 im Erdgeschoss ein öffentlicher Raum für Ausstellungen und temporäre Projekte eingerichtet. Der von den KünstlerInnen selbst organisierte Ausstellungsraum funktionierte ähnlich wie eine ProduzentInnengalerie. Alle im Haus arbeitenden KünstlerInnen konnten ihre eigenen Ausstellungen und Veranstaltungen organisieren; einzelne haben sich dabei stärker engagiert, andere kaum. So fanden in familiäre Atmosphäre viele Einzel- und Gruppenausstellungen mit den eigenen Arbeiten und mit Arbeiten von befreundeten KünstlerInnen statt, und es wurden Konzerte, Filmveranstaltungen, Diskussionen und spezielle Aktionen, wie zum Beispiel das Zürcher Fenster von <Piazza Virtuale>, einem Van Gogh TV-Projekt an der Dokumenta 1992, organisiert. Im Sommer wurde jeweils am Sonntag draussen auf der Lieferrampe Brunch serviert, und bei Eröffnungen oder nach Auftritten wurde gekocht und gegessen. Finanziert wurde der Raum zuerst über die einzelnen Mieten und später, dank der von der Stadt Zürich positiv vermerkten „Kontinuität“, auch mit Unterstützungsbeiträgen aus der Stadtkasse. Die Zukunft des Projektes wurde von dem Augenblick an unsicher, als sich die verschiedenen KünstlerInnen aufgrund von wachsendem Interesse und dank verschiedenen Stipendien und Atelieraufenthalten stärker um ihre persönliche Arbeit zu kümmern begannen. 1997 wurde der Projektraum nach der Sanierung des Gebäudes, der Verlegung des Raumes ins Untergeschoss und nach der Ausschreibung der Kuratoriumsstelle aufgelöst. Der <Projektraum Hohlstrasse> und das schon 1986 ebenfalls von KünstlerInnen gegründete <Kunsthaus Oerlikon> waren Anfang der 90er Jahre die ersten „alternativen Kunstorte“ der Stadt. Beide Orte waren eine Zeit lang die einzigen Alternativ zum etablierten Kunstbetrieb, in dem die Rollen weiterhin fest verteilt und der Zugang zur Kunstöffentlichkeit gut kontrolliert blieben. Während sich das <Kunsthaus Zürich> für die „hohe Kunst“ und das <Helmhaus> für „bewährte“ Schweizer-Positionen zuständig fühlte, entwickelte sich die <Shedhalle> Ende der 80er Jahre immer stärker zu einer jungen Kunsthalle mit internationalen Ambitionen. Für eine gemeinsame, offene, experimentelle oder projektorientierte künstlerische Arbeit gab es in dieser Konstellation tatsächlich keinen Platz, und für eine grosse Mehrheit der jungen KünstlerInnen war „das Öffnen einer Türe zur Kunstöffentlichkeit“ das zentrale Anliegen. Einige wenige wurden in dieser Situation selber aktiv, veranstalteten private Ausstellungen oder starteten Projekte. Sie wurden als KünstlerInnen ihre eigenen VermittlerInnen und gaben damit eigenen Vorstellungen von künstlerischer Arbeit Raum. Für die grosse Mehrheit der partizipierenden KünstlerInnen dienten diese Räume allerdings als Forum für den angeblich „notwendigen Zwischenschritt vor dem Einstieg in die etablierte Kunstwelt“. Viele KünstlerInnen probten hier ihre erste, zum Teil mit erheblichem finanziellem Aufwand verbundene „richtige“ Ausstellung oder zumindest das, was sie dafür hielten. Dabei orientierten sich die meisten an der Vorgehensweise von traditionellen Ausstellungsorten. Das blieb nicht ohne Folgen für die MacherInnen eines solchen Ausstellungsraumes. Im Prinzip fielen die selben Aufgaben an, die auch in einer grösseren Institution anfallen, mit dem Unterschied, dass es dafür kaum angemessene personelle und finanzielle Ressourcen gab. Es wurden Karten und Plakate gestaltet, Einladungen verschickt, Pressearbeit gemacht, Vernissagen und Führungen organisiert, das Programm dokumentiert und Fundraising betrieben – letztlich mit mässigem Erfolg und mit dem eher fragwürdigen Effekt, von der avisierten Kunstöffentlichkeit langsam als d e r Ort für „AnfängerInnen“ anerkannt zu werden. Dabei sein genügt schon Eingeladen wurde mit einem Flyer. Die Suche nach der angegebenen Adresse führte schliesslich in eine Art Hinterhof eines Baugeschäfts mit alten leerstehenden Lagergebäuden und eigenartigen Holzkonstruktionen, halb Regal, halb Scheune. Im ersten Stock, am Ende eines schmalen, staubigen Korridors, war in dieser Nacht wieder „Lagerbar“. In einem Regal flimmerte ein graues Videobild aus einer alten Überwachungskamara, die hinter der Bar angebracht war. Wer anwesend war, konnten sich gleich selber sehen. In den schmalen Durchgängen zwischen den Regalen war ein grosses Gedränge, und wer etwas von den vielen eingelagerten Kunstwerken sehen wollte, musste warten, bis eine Leiter frei wurde, um einen Einblick in die oberen Etagen zu bekommen. <Das Lager>, welches von 1993 bis 1998 gelegentlich und immer an wechselnden Orten stattfand, wurde von einem Künstler und einem Architekten organisiert. KünstlerInnen aus verschiedenen Generationen und Szenenwurden aufgefordert, „überflüssige Kunstwerke“ vorbeizubringen und vorübergehend einzulagern. Zu jedem Baranlass wurden neue Werke abgeliefert, gelagerte Werke zurückgezogen oder ausgetauscht. Die beiden Veranstalter nannten sich „Lageristen“ und führten mit Eifer genau Buch darüber, was an welcher Stelle und in welcher Kiste Platz fand. Die Dienstleistung zur Einlagerung von Kunstwerken kann als ein ironischer Kommentar zum aufwändigen Produzieren und Lagern „überflüssiger“, unbeachteter Kunst verstanden werden. Weit wichtiger als die gelagerten Werke war jedoch der soziale Kontakt. <Das Lager> deckte ein weit verbreitetes Bedürfnis nach Begegnungsorten ab, die vor der etablierten Kunstöffentlichkeit geschützt sind. Die sozialen Räume und Rituale im Umfeld von Bildender Kunst, wie Ausstellungseröffnungen sind stets symbolisch aufgeladen und erfüllen repräsentative Funktionen. Die Kommunikation verläuft entlang der hierarchischen Ordnung von realer oder eingebildeter Macht der einzelnen ProtagonistInnen. Dabei werden Rollen festgeschrieben und bestätigt. In der Lagerbar waren die üblichen Regeln der Kunstwelt in mehrfacher Hinsicht aufgehoben. Anstelle der Selektion von Namen und der Segretion von Positionen trat das Prinzip der Partizipation. Die üblicherweise im Zentrum stehenden Werke der KünstlerInnen waren nunmehr ein willkommener Anlass, gemeinsam an der Bar eine Nacht lang zu feiern. Eine ganze Reihe von ähnlichen Projekten verfolgte dieselbe Strategie. Ohne Vorgaben zu machen, Themen vorzugeben oder Rollen festzulegen, konnten alle, die Lust hatten, daran teilnehmen. Verschiedene KünstlerInnen wurden abwechselnd zu OrganisatorInnen und VermittlerInnen und luden ihre KollegInnen zum Mitmachen ein. Die verschiedenen Anlässe wurden mit sehr unterschiedlichem finanziellem und organisatorischem Aufwand aufgezogen und einmal im eher privaten und dann wieder im eher öffentlichen Rahmen durchgeführt. Wichtiger als der hohe Anspruch an ein Kunstwerk war es, als Bar und Party Furore zu machen. Dies war angesichts der grossen Konkurrenz durch unzählige illegale Bars, die zur selben Zeit existierten, kein einfaches Unterfangen. Die Anlässe fanden in neu erschlossenen und deshalb auch oft spektakulären versteckten oder öffentlichen Räumen statt wie z.B. in Industriebrachen im Schölerareal (<Kunststandort Zürich>, 1994), in Unterführungen (<U-Passage>, <Jäger und Sammler>, 1997), aber auch in der Halle des Hauptbahnhofs (<… ein artig kommen und Gehen>, 1994, 1995) und sogar im Helmhaus (<Inventar> im Rahmen der Kunstszene, 1995). Die Funktion des Sozialen in der kulturellen Praxis wurde im Rahmen unzähliger selber organisierter Events neu entdeckt und erprobt. Die dadurch entstandene Sensibilität für soziale Happenings und die Lust auf Begegnung stellten aus heutiger Sicht allerdings weder traditionelle Begriffe von Kunst noch Vorstellungen, wie diese legitimiert wird und an wen sie sich zu richten hat, je grundsätzlich in Frage. An der Lagerbar oder für die Weihnachtsausstellung in den Vitrinen der <U-Passage> wurden weiterhin einzelkünstlerische Werke abgeliefert. Sie bildeten schliesslich skurrile Sammlungen eigenartiger Miniaturen in einem belanglosen Nebeneinander von unterschiedlichen Geschmäckern und Materialien, die mit grossem Aufwand verwaltet werden mussten. Der fehlende „Wille zur Differenzierung“ wurde von Institutionen und Galerien als Vorwand benutzt, sich nicht für die KünstlerInneninitiativen zu interessieren, sondern diese als „harmlos, lokal und provinziell“ abzuqualifizieren. Diese Wertung galt vor allem einzelnen KünstlerInnen und Werken und ignorierte dabeidie soziale Dimension solcher Anlässe. Im Rahmen der von den KünstlerInnen selber gestalteten Jahresausstellung fand 1995 im <Helmhaus> mit der Ausstellung <Inventar> das bisher grösste „get together“ der lokalen Szene statt. Auf elektronischem Weg wurden von möglichst allen KünstlerInnen des Kantons Zürich Daten und Arbeitsdokumentationen zusammengetragen und über Computerterminals für die Dauer der Ausstellung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. An wen sich die mit grossem Aufwand produzierte Geste vereinter Präsenz im Datennetz nun richtete und wer mit dieser neuen Dimension von Verfügbarkeit etwas anfangen konnte, wurde nie deutlich. Von der spontanen sozialen Dynamik temporärer und partizipativer Projekte blieb nur die Verwaltung, Archivierung und individuelle Verwertung. Zwischen 1996 und 1998 gab es in Zürich eine ganze Reihe neuer Initiativen für unabhängige, temporäre und interdisziplinäre Aktions- und Projekträume. Sie nannten sich <All>, <Message Salon>, <Kombirama>, <Klinik>, <Hotel>, <Edengarage> oder <Blauer Saal> und wurden von KünstlerInnen, StudentInnen der Schule für Gestaltung, MusikerInnen und anderen AkteurInnen, die sich zuvor schon in der illegalen Bar- und Party-Szene engagiert haben, ins Leben gerufen und betrieben. Zu dem Zweck bildeten sich verschiedene heterogene Gruppen und Zusammenschlüsse, welche zum Teil auch miteinander vernetzt waren. Die neuen Projekte verstanden sich nicht nur als alternative Kunst-Vermittlungs-Räume, sondern eher als vorübergehende „location“ zur Verwirklichung unterschiedlichster Veranstaltungs- und Projektideen. Dazu gehörten neben DJing, Trashdesign, Gebasteltem, Homestyle und Alltagskitsch vor allem viel Selbstdarstellung und Community-Gefühl. Entscheidend geprägt wurden die Programme durch das gleichwertige Nebeneinander von Ausstellungen, Partys, Musikevents, Kursen und Workshops, Diskussionen und Barbetrieb. Die verschiedenen Räume wurden fast alle auf der Basis einer temporären Zwischennutzung von leerstehenden Räumen oder Gebäuden betrieben. Das vorgefundene Ambiente und der zufällige Chic – etwa der mit grünem Spannteppich ausgestattete Business-Showroom von <Kombirama> oder das Spitalinterieur der <Klinik> – waren wichtige, integrative Aspekte und prägten das jeweilige Image. Fast alle diese Projekte finanzierten sich selber oder erhielten nur marginale Unterstützungsbeiträge. Ähnliche Räume entstanden übrigens – zum Teil auch schon einige Jahre davor – in Deutschland, Österreich, Skandinavien und England (siehe dazu <Compartments>, herausgegeben von von Simon Shike). Begehren wecken und Wünsche erfüllen Eigentlich hätte es ein seriöser und wichtiger Anlass werden sollen, der Suche nach Sponsorengeldern gewidmet. Aber wie die einschlägigen Erfahrungen zeigten, war es nicht ganz einfach, die Bedeutung von einem Unternehmen wie dem <Kombirama>, jemandem ausserhalb der Kunstszene plausibel zu machen. Zuvor war bereits die Idee fehlgeschlagen, Büropflanzen aus den umliegenden Gewerbegebäuden über die Sommerferien in Asyl zu nehmen und ihnen somit regenerierende Momente im kulturellen Ambiente zu ermöglichen. Auf unsere Anfragen hin hat sich niemand gemeldet. Nun sah es auch für diesen Abend so aus, dass von den zahlreichen angeschriebenen Firmen und Unternehmen niemand auftauchen würde. Wir konzentrierten uns deshalb darauf, bei Barbetrieb und blubbernder Musik Logos mit Fingerfarbe auf die Schaufenster zu malen. Fotos von den verschiedenen Business Centern in der Umgebung, mit ihren Leuchtschriften und Firmentafeln dienten uns als Vorlage. Es war nicht ganz einfach, die Zeichen und Schriften ad hoc seitenverkehrt aufs Glas zu zeichnen. Es entstanden selbstverständlich auch einige Fehler – so war das Logo der Post gegen rechts eigenartig verzerrt oder hiess es plötzlich „Stanly Bostich“, weil das „e“ vergessen ging, und bei Credit Suisse war das „S“ spiegelverkehrt geraten. (Diese kleinen Missgeschicke bescherten uns in den darauffolgenden Wochen übrigens viele spontane Besuche von irritierten MitarbeiterInnen der besagten Firmen, welche wissen wollten, was hier eigentlich los sei.) Je mehr BesucherInnen im Laufe des Abends kamen, desto schneller geriet das Malen dann auch bald in den Hintergrund, und nachdem die rote Fingerfarbe ausgegangen war, wurde fast nur noch getanzt. Für wenige Momente waren in kollektiven Projekten wie dem <Kombirama> die üblichen Leistungsanforderungen und Distinktionskriterien ausser Kraft gesetzt. Anstelle von Auswahl, Bewertung und strategischem Handeln traten spontane Entscheidungen und die Lust, etwas gemeinsam auf die Beine zu stellen. Plötzlich entwickelten alle viele gute Ideen, die ganz einfach und naheliegend waren und sofort umgesetzt werden konnten. Ständig wurden neue Crossover mit Kunst, Alltagskultur und Popkultur ausprobiert und damit neue Öffentlichkeiten erfunden. Die soziale und kreative Intensität, welche in solchen Momenten freigesetzt wurde, war an eine Art improvisierte, offene aber solidarische Selbstbezogenheit und Absichtslosigkeit gebunden. Nach einigen Wochen schlichen sich in den laufenden Prozess – zum Teil auch als Reaktion auf das zunehmende öffentliche Interesse – allerdings wieder Regeln und Rollen ein wie z.B. die selbst auferlegte Verpflichtung, ständig für neue Überraschungen zu sorgen, immer wieder ein neues Programm zu erfinden oder ein „guter“ Gastgeber zu sein. Es wurde bald klar, dass der temporäre Charakter, der schon durch den begrenzten Mietvertrag gegeben war, eine wesentliche Bedingung für das Gelingen von <Kombirama> war. Kontinuierliche Entwicklungen und die dazu gehörenden Strategien der gezielten Erschliessung von neuen Ressourcen oder einem breiteren Publikum waren nie wirklich ein Thema. Das ganze Projekt unterlag der Logik einer Ökonomie der Verschwendung, des Potlatsch, das sich gegen das sonst übliche Prinzip der Akkumulation, des Wachstum und der Kontrolle richtete. Aufgetaucht sind an jenem Abend im <Kombirama> auch VertreterInnen von Institutionen und Galerien. Das besondere Ambiente und die gezielte Absichtslosigkeit dieses „gescheiterten“ Sponsoringevents waren offensichtlich auch für die am „globalen Kunstmarkt“ angeschlossenen Kunstverwalter und Vermittler attraktiv. Gerade die unabhängigen Gruppen und Initiativen, welche seit Mitte der 90er Jahre überall aktiv wurden und in ihrer künstlerischen Praxis Privates und Selbstbestimmtes mit Pop- und Alltagskultur zu vermischen begannen, passten in den allgemeinen Trend einer zunehmenden Kulturalisierung des Alltags und der Ökonomie. Aus dieser Erkenntnis wuchs nicht nur das allgemeine Interesse an „junger“ Kunst und Popkultur sondern zum Beispiel auch das Bedürfnis, das Kulturangebot „besser“ zu verwalten und „professioneller“ zu fördern. Im Kulturkonzept der Stadt Zürich wird 1995 das in der Stadt bestehende Kulturangebot sorgfältig analysiert und beschrieben. Dabei werden nun auch den unterschiedlichsten alternativen kulturellen Aktivitäten und Initiativen ohne dass diese je zuvor substanzielle öffentliche Unterstützung erhalten hätten, offiziell anerkannte Funktionen zugesprochen. Die Förderbeiträge für Bildende Kunst in Form von Stipendien und Werkankäufen werden im Laufe der 90er Jahre immer gezielter dafür eingesetzt, eine dem internationalen Standard entsprechende Elite zu fördern. Die dafür zuständige Fachkommission wurde „professionalisiert“, und Ankäufe wurden vermehrt in privaten Galerien und dafür weniger in den öffentlichen Ausstellungen und Jahresausstellungen getätigt. Auch die jährliche Jurierung des eidgenössischen Stipendienwettbewerbs für Bildende Kunst findet seit einigen Jahren gleichzeitig mit der <Art Basel> statt. Mit der gemeinsamen Eröffnung verschiedener Galerien, der Kunsthalle und einem neuen Museum für Gegenwartskunst der Migros im Löwenbräuareal Zürich bildete sich 1996 auch jener strategische Vermittlungskomplex, der nun in der Lage war, auf der High Art-Ebene neue Trends zu behaupten. Das Jugendimage einer „spielerischen, lockeren, respektlosen“ und unabhängigen Szene wurde überall dort aufgegriffen, wo neue Märkte installiert und ein neues Zielpublikum kreiert werden sollten. Bei der <Jungen Liste 1998>, dem parallel zur Art in Basel stattfindenden Kunstmarkt der „jüngeren“ Galerien, konnte man konsequenterweise als BesucherIn das Raumsetting und die Einrichtung nicht mehr von der Lounge eines „Independent Space“ unterscheiden. Die Eventkultur und das Soziale der Off-Szene wurden von einigen Galerien und Institutionen als Image sofort übernommen und gezielt für die Selbstpositionierung als „trendbewusstes“ Unternehmen eingesetzt. Die bald nach dem „Fingerfarben-Abend“ eingetroffene Anfrage, ob <Kombirama> nicht die nächste Party für die Eröffnung der Galerien und Museen im Löwenbräuareal organisieren könnte, löste im Team eine Kontroverse aus. Wir entschieden uns schliesslich, eine angemessene Summe Geld zu verlangen, um die Tauschverhältnisse klarzustellen. Dieser Vorschlag wurde von den Galeristen empört abgelehnt. Die gelungenen Events sind immer auch diejenigen Momente, in welchen Legenden geboren und neue Verwertungsstrategien erfunden wurden. So stellte <Kombirama> in den Augen der absichtsvollen (Kunst-)Öffentlichkeit schon bald und bis heute ein vielversprechendes Vakuum von Möglichkeiten und ein offenes Gelände für Projektionen und Spekulationen dar. Um als unabhängiges und spontanes Projekt längerfristig eine autonome kritische Position behaupten zu können, wäre eine Form von Einigung bezüglich des Umgangs mit divergierenden Meinungen der Teammitglieder nötig gewesen. Dafür reichte weder Zeit noch Energie, und das hätte einen Prozess benötigt, der in einem Widerspruch zur Lust auf spielerische Selbstinszenierung stand. Neue Kontakte, Diskussionen und Netzwerke Die Diskussion fand im Februar 1997 im Rahmen von <public utility> im <Kombirama> statt und drehte sich um die Frage nach dem Selbstverständnis von Off-Gruppierungen und ihrer Haltung gegenüber Institutionalisierungseffekten. <public utility> war ein informelles Treffen verschiedener selbstorganisierter Räume und Gruppen aus ganz Europa. Angeregt von ähnlichen Veranstaltungen u.a. in Köln, <Messe2ok> und Berlin, <minus96>, sollte <public utility> zu einer bewussteren und kritischeren Haltung gegenüber der eigenen interdisziplinären Arbeit beitragen. Während einer Woche wurden Projekte vorgestellt und Ideen ausgetauscht, verschiedene Themen diskutiert und dabei einige wesentliche Punkte einer „gegenkulturellen Praxis“ herausgearbeitet. Bei dieser Gelegenheit wurde von DiskussionteilnehmerInnen, welche eher eine Vermittlungsposition vertraten, einmal mehr die These eingebracht, dass kollektive Projekte oder selbstorganisierte Räume nur einen Zwischenschritt in Richtung zunehmender Etablierung und Institutionalisierung darstellen würden und die eigentliche Motivation, sich im kollektiven Kontext zu engagieren, sei, mit der eigenen Arbeit einen Weg zur Kunstöffentlichkeit zu finden. Dieser These haben einige ProduzentInnen zu Recht vehement widersprochen. Selbstverständlich gibt es zwischen dem, was früher traditionell als Werk eines/einer KünstlerIn galt, und den selbstorganisierten Projekten längst fliessende Übergänge. Die aktuellen Arbeitsweisen und Strategien lassen sich nicht länger als abgegrenzte Kategorien wie „Mainstream“ und „Off-Szene“ beschreiben. Die Wahl der Arbeitsweise und die Ausrichtung auf einen bestimmten Kontext sind strategische Mittel der künstlerischen Produktion genauso wie die Entscheidung, sich als KünstlerIn innerhalb oder ausshalb von bestimmten Institutionen oder Kreisen zu positionieren. Aber tatsächlich hat die traditionelle Kunstgeschichtsschreibung bis anhin die Kunst immer wieder als eine eigene homogene und aus den übrigen gesellschaftlichen Zusammenhängen herausgehobene Sphäre aufgefasst und die laufenden Veränderungen und Erneuerungen auf die Leistungen einzelner „genialer“ KünstlerInnensubjekte zurückgeführt. In einem solchermassen unpolitischen und elitären Kunstbegriff kommen kollektive Bewegungen, temporäre Projekte und selber definierte, nicht standardisierte Vorstellungen von Öffentlichkeit nicht vor. Im Laufe der 80er und 90er Jahre entstanden erst in den USA und später in Europa verschiedene kritische Gruppen und Zusammenhänge, welche unter Rückbesinnung auf die situationistische und aktionistische Praxis der 70er Jahre „institutional critique“ betrieben und die Funktion von Kunst als Legitimation für gesellschaftliche Differenzen und die Rolle von KünstlerInnen als authentische AutorInnen in Frage stellten. Private und institutionelle Herrschaftsstrukturen innerhalb traditioneller Kunstinstitutionen und ihr Einfluss auf den Ein- oder Ausschluss bestimmter künstlerischer Positionen wurden untersucht und offen gelegt und die Rolle, die der Kunstmarkt bei der Stabilisierung eines konservativen Kunstbegriffs spielt, analysiert. Im Rahmen von interdisziplinären Projekten gelang es immer wieder, andere, aus dem Kulturbetrieb normalerweise ausgeschlossene Gesellschaftsgruppen anzusprechen, zu involvieren und damit eigene (gegenkulturelle) Öffentlichkeiten zu bilden. Verschiedene Gruppen und KünstlerInnen haben den Kunstkontext mit seinen Ressourcen und seiner Öffentlichkeit gezielt genutzt, um mit ihren Arbeiten und Interventionen einen kritischen Diskurs über politische Themen wie Ökonomie, Stadtentwicklung, Technologie- und Medienkritik oder die Aids-, Rassismus- und Genderdebatte zu führen und weiterzuentwicklen. Und schliesslich entstanden in den 80er und 90er Jahren eine ganze Reihe von politischen Bewegungen und kritischen Interventionen aus der Kunstszene heraus (<act up>, <Innenstadtaktionen>, <get to attack> u.a.). Diese kulturelle Praxis wurde phasenweise auch von einigen Institutionen aufgenommen, mitgetragen und gefördert – eine der wichtigsten in diesem Prozess war seit 1994 die Shedhalle in Zürich – und in eigenen Fanzines (z.B. <A.N.Y.P.>, <k-Bulletin>, <Starship>) und Kunstzeitschriften (<Texte zur Kunst>, <SpringerIn>) kommentiert und dokumentiert. Die Diskussionen im Rahmen von <public utility> zeigten, dass eine unabhängige Position in der kulturellen Arbeit die kontinuierliche Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Funktionen von Kultur und den daran anknüpfenden Interessen und Identitätskonzepten voraussetzt. Als Bezugssystem dafür ist der konventionelle Kunstkontext ungeeignet; eine brauchbare Grundlage bildet viel eher die aufgearbeitete Geschichte gegenkultureller Bewegungen und der Austausch mit anderen Gruppen. Die subkulturelle Bewegung entwickelt sich kontinuierlich in einem sich ständig transformierenden Netzwerk von aktiven Szenen, Initiativen und Einzelpositionen zu Themen und Anlässen mit wechselnden Zielen oder Utopien. Die Kurzfristigkeit und Spontaneität von Kollektiven wie dem <Kombirama> ergibt sich aus der Tatsache, dass eine lokale Szene, die zu einem bestimmten Zeitpunkt Ausgangsbasis für gemeinsame Aktivitäten sein kann, mit der Zeit von neuen Beziehungsnetzen und Interessen überlagert wird. Dabei bilden sich ständig neue Projekte, Arbeitsbereiche und Zusammenhänge heraus, die sich je nach Anlass orientieren und sich an unterschiedliche Öffentlichkeiten richten. Der skizzenhafte und prozesshafte Charakter kann deshalb nicht als ein Zeichen für das Scheitern solcher Unternehmen aufgefasst werden, und „Independency“ lässt sich nicht einfach durch die symbolische Vereinnahmung herstellen, wie dies zum Beispiel bei der Einführung jugenkultureller Images und der Partykultur in den Kunstraum versucht wurde. Ein Jahr nach <public utility> kam es an einer Veranstaltung im Zusammenhang mit dem Ausstellungsprojekt <Schnittstelle/Produktion> in der Shedhalle Zürich zur ersten offiziellen Begegnung zwischen verschiedenen AktivistInnen aus den unterschiedlichen selbstorganisierten Projekten. Anwesend waren u.a. VertreterInnen von <Klinik>, <Hotel>, <Message Salon>, <k3000/Kombirama> und <Edengarage>. Im Raum stand die Frage nach dem Selbstverständnis als ProduzentIn oder ProduzentInnenkollektiv und nach der strategischen Positionierung der eigenen Produktion. Die Antworten waren angesichts der grossen Wellen, welche die Aktionen einiger dieser Gruppen bereits geschlagen hatten, ernüchternd. Die meisten hatten sich diese Frage noch nie gestellt, andere handelten aus „persönlichem Interessen“ oder „einfach aus Lust an der Sache“. Internationale Kontakte gab es kaum. An einer Überlagerung und Vernetzung der unterschiedlichen Aktivitäten im lokalen und internationalen Rahmen war niemand richtig interessiert. Der gelegentliche Erfahrungsaustausch oder gar ein ernsthafter Diskurs fand bisher nicht einmal unter den in der selben Stadt aktiven Gruppen statt. Angesichts der fehlenden Vernetzung war es denn auch nicht erstaunlich, dass niemand wusste, worauf man sich mit den eigenen Aktivitäten beziehen könnte. Die AkteurInnen bestätigten sich durch die unreflektierte Kultivierung eines Szenengefühls einmal mehr gegenseitig als autonome KünstlerInnensubjekte. Ein letzter Blick aufs Mittelmeer Die Ausstellung sollte bahnbrechend und noch nie dagewesen werden, jung und aktuell. Das jedenfalls konnte man aus unzähligen, vor der Eröffnung erschienenen Presseartikel und Vorbesprechungen schliessen. Im Höhepunkt einer Bewegung von unabhängigen Gruppen und Projekten, von vielen mehr oder weniger ambitionierten Selbstinszenierungen und coolen Partys plante und realisierte das Kunsthaus Zürich 1998 eine grosse Ausstellung junger Schweizer Kunst. Die Wahl des Titels der Ausstellung „Freie Sicht aufs Mittelmeer“, die salonfähigere Hälfte eines bekannten Slogans der autonomen 80er Bewegung „Nieder mit den Alpen! Freie Sicht aufs Mittelmeer!“, begründet die Kuratorin in der Einleitung zum Ausstellungskatalog in einer zugleich wohlwollenden wie qualifizierenden Geste mit „dem seit den 80er Jahren erheblich erweiterten Horizont“ der hiesigen Kunstszene. „Erfinderisch entdeckte man ungeahnte Möglichkeiten, so dass die Unzufriedenheit nicht nur in ein pragmatisches Voranschreiten und Operieren mündete, sondern in eine funkensprühende Konzentration und Umverteilung, in ein Einfliessenlassen künstlerischer Ereignisse in bis anhin nicht dafür vorgesehene Orte.“ Die Begeisterung für „faszinierende ästhetische Phänomene“ und die Ignoranz für die damit verbundenen kulturellen, sozialen und politischen Prozesse und Anliegen entsprechen im wesentlichen der Strategie jeder „Hight Art Institution“, wenn sie sich an „junge Szenen“ heranwagt. Das Bemerkenswerte am Phänomen „Mittelmeer“-Ausstellung war das unmittelbare Andocken an laufende kulturelle Prozesse und der gezielte Einsatz von szenenbezogenen Botschaften und Images. Man könnte eigentlich von einer Marketing-Offensive reden. Die Ausstellung wurde über Plakate und Einladungskarten trendig kommuniziert und in Presseartikeln vielversprechend angekündigt. Sie war von einer Vielzahl von interdisziplinären Events begleitet. Der Katalog war eine Mischung aus Kunstkatalog und Szenenführer. Er enthielt neben den üblichen Werkabbildungen und Biografien ein umfangreiches Verzeichnis aller „art-locations“ der Schweiz und ein ganzes Kapitel mit Szenen-Fotos von Eröffnungen und anderen In-Events. Im Verzeichnis der Kunstorte tauchten neben den Kunsthallen und dem Migros-Museum ganz selbstverständlich auch alle temporären und selber organisierten Räume und Projekte auf. Ein paar dieser Gruppen wurden eingeladen, sich Sonntag Nachmittag auf der Wiese hinter dem Kunsthaus mit eigenen Aktionen auch noch „life“ vorzustellen. Für die Eröffnung und die Finissage wurden grosse Partys organisiert, an welchen die gesamte Kunstszene anwesend war. Die eigentliche Ausstellung, so schien es, rückte angesichts der vielen Image bildenden Massnahmen und Begleitprogrammen fast in den Hintergrund. Um den passenden historischen Kontext für die Ausstellung mitzuliefern, wagt der Co-Kurator in seinem Katalogbeitrag gleich noch eine eigene Interpretation der näheren Schweizer Kulturgeschichte. So schweift er vom Ende des Zürcher AJZ der 80er Bewegung, das durch „Drogendeal, Beschaffungskriminalität und Hehlerei“ vom „Luftschloss“ zu einem „verkommenen Räubernest“ gemacht worden wäre, über die Migros als identitätsstiftende Institution für alle SchweizerInnen zu den „Independent Spaces“, welche nun die Szene bestimmen und für „fluktuierende“ Wirklichkeiten sorgen würden. Mit Bezug auf Paul Nizon führt er Fischli/Weiss als Beispiel dafür an, dass man sich auch „ganz ohne den leidenden Gestus heimatloser Linker“ durch die Welt schlagen könne. Ganz so ideologieneutral und machtfrei wie die kulturelle Wirklichkeit im Katalog heraufbeschworen wird, stellte sie sich allerdings weder aus der Perspektive des Kunsthauses noch aus jener der KulturproduzentInnen dar. Tatsache ist, dass die meisten in der Ausstellung vertretenen KünstlerInnen gar nichts mit den in den Vordergrund gerückten selbstorganisierten Szenen zu tun hatten, und umgekehrt viele der in unabhängigen Projekten aktiven KünstlerInnen nur am Rande, in den Rahmenveranstaltungen oder überhaupt nicht vorkamen. Für Institution sind neue kulturelle Entwicklungen nur auf der symbolischen Ebene interessant. Sie liefern wie im Fall der „Mittelmeer-Ausstellung“ höchstens den äusseren Anlass, um eine Auswahl von Einzelpositionen in einen scheinbar spannenderen Kontext zu stellen. Der Trend zur imagemässigen Kontextualisierung von grossen Ausstellungen hängt mit dem offensichtlich härter werdenden internationalen Wettbewerb um Kapital und Prestige zusammen, in welchem die grossen Institutionen gegeneinander stehen. Dabei zählen einzig bekannte Namen oder aber neue Themen. Ausser dem subkulturellen Flair dienten Ende der 90er Jahre immer häufiger auch politische Themen als Aufhänger für eine weitere Gruppenausstellung von künstlerischen Einzelpositionen. So lange keine andere Öffentlichkeit für die eigene kulturelle Praxis existiert, ist man als KünstlerIn weiterhin auf minimale Repräsentation in einem breiteren Kunstkontext angewiesen. Deshalb wird auch kaum jemand die Teilnahme an der Ausstellung im Kunsthaus abgesagt haben, obschon der gegebene Rahmen und die Verortung der einzelnen Arbeiten, für viele falsch war. Solche Kompromisse müssen in Kauf genommen werden, weil in dem vom globalen Kunstmarkt dominierten Umfeld kaum Vermittlungsstrukturen existieren, welche in der Lage sind, kulturelle Basisarbeit zu fördern, und es darüber hinaus kaum Institutionen gibt, die sich im Hinblick auf die immer stärker ausdifferenzierten Haltungen und Arbeitsweisen von KünstlerInnen verändern und spezialisieren würden. Nur zwei Jahre nach der „Mittelmeer-Ausstellung“ sieht sich die Findungskommission des Kunsthauses dem direkten Druck gewichtiger Sammler und Donatoren ausgesetzt, welche vom zukünftigen Direktor ein internationales, der klassischen Moderne verpflichtetes Format fordern, eine anerkannte Kapazität, ein „Pereira“ der Kunst, der das Millionenbudget angemessen verwalten kann und für die nötige Reputation sorgt. Im Löwenbräuareal haben sich kapitalstarke „Global Players“ durchgesetzt, die dank gezielten Mergers in ganz neue Dimensionen des Kunstbusiness vorstossen. Aus den verschiedenen in Zürich aktiven Off-Szenen wurden bis Ende der 90er Jahre zwei, drei Namen in den Kunstmarkt weitergezogen. Sie werden in Zukunft die begrenzte Nachfrage nach Positionen im Geschmack der späten 90ern abdecken müssen. Das traditionelle Kunstsystem hat einmal mehr – darüber täuschen selbst die hypsten Einladungskarten und die progressivsten Eventsettings nicht mehr länger darüber hinweg – seine konservative Nachhaltigkeit bewiesen. Nur die Fragen, was Kultur eigentlich ist, wer sie macht, wer sie beschreibt und wer sie legitimiert bleiben trotz kaufkräftiger Normalität weiterhin offen. Aber anderswo sind längst spannendere Dinge am Laufen. Sollten wir uns treffen? Wie wär‘s gleich morgen Abend? © Peter Spillmann, 3/2000 |